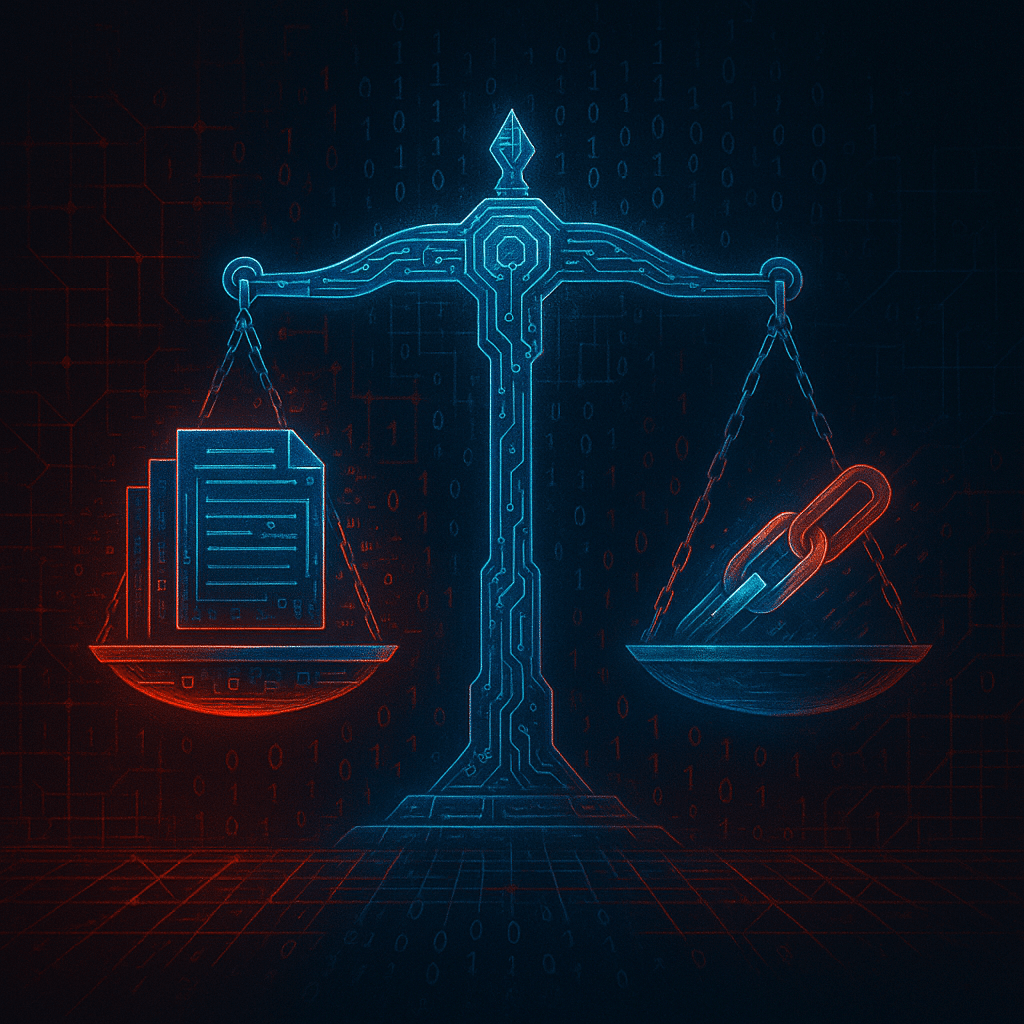
Gesetz zur weiteren Digitalisierung der Justiz: Überblick über die wichtigsten Änderungen
Am 16. Juli 2024 wurde das „Gesetz zur weiteren Digitalisierung der Justiz“ im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Ziel der Neuregelungen ist es, den elektronischen Rechtsverkehr zu stärken und die digitale Transformation innerhalb der Justiz konsequent voranzutreiben. Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über die zentralen Änderungen, die insbesondere Gerichte, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Verfahrensbeteiligte betreffen.
Elektronischer Rechtsverkehr im Fokus
Kernstück des Gesetzes ist der Ausbau des elektronischen Rechtsverkehrs. Bereits heute sind elektronische Einreichungen in vielen Verfahren verpflichtend – das neue Gesetz erweitert und konkretisiert diese Vorgaben. Der elektronische Zugang zur Justiz wird weiter standardisiert und modernisiert. Ziel ist es, den Schriftverkehr vollständig digital abzuwickeln, ohne Medienbrüche.
Einführung der elektronischen Verfahrensakte
Ein bedeutender Schritt ist die flächendeckende Einführung der elektronischen Verfahrensakte. Ab dem 1. Januar 2026 müssen Gerichte und Staatsanwaltschaften grundsätzlich vollständig digital arbeiten. Das betrifft insbesondere Zivil‑, Verwaltungs‑, Sozial‑, Arbeits- und Finanzgerichte. Für Verfahren mit besonders schutzbedürftigen Inhalten – etwa mit Verschlusssachen – gilt eine verlängerte Übergangsfrist bis zum 1. Januar 2036.
Für Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, bei denen vor dem 1. Januar 2026 noch Papierakten geführt wurden, sieht das Gesetz die Möglichkeit einer sogenannten Hybridakte vor. In diesen Fällen können Papierakten weiterhin verwendet werden, während neue Bestandteile elektronisch ergänzt werden. Diese Regelung soll einen praxisgerechten Übergang gewährleisten, ohne dass Verfahren neu aufgesetzt werden müssen.
Stärkung der digitalen Infrastruktur
Zur Unterstützung der digitalen Justiz werden bestehende Systeme und Plattformen weiterentwickelt:
- Gemeinsames Fachverfahren (GeFa): Die Entwicklung einer einheitlichen Fachanwendung für die Gerichte aller Gerichtsbarkeiten wird vorangetrieben. Damit sollen Datenstrukturen harmonisiert und die Verwaltung vereinfacht werden.
- Elektronisches Bürger- und Organisationenpostfach (eBO): Bereits eingeführt, ermöglicht es Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen eine gesicherte elektronische Kommunikation mit der Justiz.
- „Mein Justizpostfach“ (MJP): Als benutzerfreundliche Plattform soll es den Zugang zur Justiz insbesondere für nicht-professionelle Verfahrensbeteiligte erleichtern.
- Informationsportal zur Videoverhandlung: Das Portal bündelt Informationen und Anleitungen rund um die Durchführung von Videoverhandlungen und soll deren Einsatz in gerichtlichen Verfahren weiter fördern.
Übergangsregelungen und Fristen
Die umfassenden Änderungen werden nicht abrupt umgesetzt. Neben der Möglichkeit der Hybridakten sieht das Gesetz zahlreiche Übergangsfristen vor. Diese betreffen etwa die Ausstattung der Gerichte mit der notwendigen technischen Infrastruktur oder die Anpassung interner Verfahrensabläufe. Dadurch soll sichergestellt werden, dass der digitale Wandel auch organisatorisch und personell bewältigt werden kann.
Ausblick
Das Gesetz zur weiteren Digitalisierung der Justiz stellt einen zentralen Baustein in der Modernisierung der Justizverwaltung dar. Es schafft klare Rahmenbedingungen für den digitalen Rechtsverkehr, fördert Transparenz und Effizienz und erleichtert den Zugang zur Justiz. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie gut die praktische Umsetzung gelingt – und ob die Justiz damit fit für das digitale Zeitalter wird.
Daina arbeitet als Legal Tech Engineer bei einer Großkanzlei in Düsseldorf. Ihre Begeisterung für Legal Tech vertiefte sie während ihres LL.M.-Studiums, das ihr fundiertes Wissen über die Schnittstelle von Recht und Technologie erweiterte. Zusätzlich engagiert sie sich als Vorstandsmitglied des Legal Tech Labs und teilt ihr Fachwissen regelmäßig durch Blogbeiträge.

