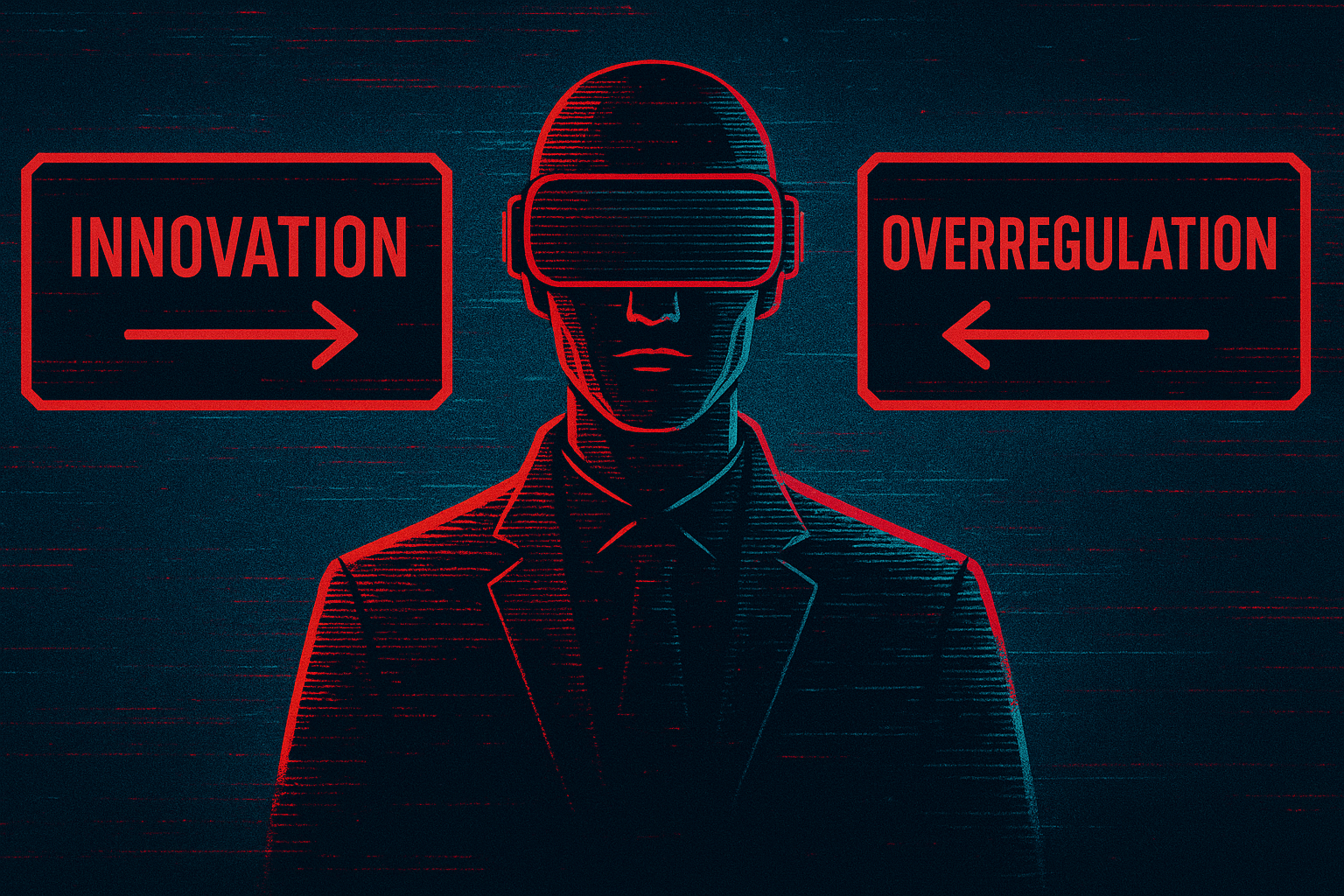
EU AI Act: Bremse oder Motor der Digitalisierung in der Verwaltung?
Die EU-KI-Verordnung (EU AI Act) ist seit dem 1. August 2025 in Kraft und gilt als weltweit erster umfassender Rechtsrahmen für Künstliche Intelligenz. Sie soll Risiken begrenzen, Grundrechte sichern und zugleich Innovation sowie Vertrauen in KI-Systeme fördern. In der Verwaltungspraxis zeigt sich jedoch: Unsicherheit über den Anwendungsbereich, Risikoaversion und fehlendes technisches Know-how könnten die Verordnung zur Digitalisierungsbremse machen, ähnlich wie zuvor die DSGVO.
Unklarer Anwendungsbereich: Was fällt unter die KI-Verordnung?
Ein Hauptproblem liegt in der Definition von KI-Systemen im EU AI Act. Diese ist weit gefasst und führt dazu, dass auch einfache Anwendungen, wie Chatbots, Spamfilter oder Auto-Vervollständigungsfunktionen, unter die Regeln fallen können. Eigentlich richtet sich die Verordnung primär an komplexere Machine-Learning-Verfahren.
Besonders schwierig ist die Abgrenzung hybrider Systeme, die feste Entscheidungslogiken mit lernenden Komponenten kombinieren. Ohne eindeutige Leitlinien fehlt Verwaltungen die Sicherheit, welche Software tatsächlich reguliert werden muss. Zwar hat die EU-Kommission ergänzende Leitlinien angekündigt, die Überregulierung vermeiden sollen, dennoch bleibt die Rechtsunsicherheit bestehen.
Risikoaversion und Fachkräftemangel: Warum viele KI-Projekte scheitern
Neben juristischen Unklarheiten bremsen organisatorische Faktoren: Viele Behörden handeln risikoscheu und warten ab, um Sanktionen zu vermeiden. Hinzu kommt ein Mangel an technischer Expertise im Umgang mit modernen KI-Anwendungen wie Machine Learning oder generativer KI.
IT-Abteilungen sind häufig mit dem Betrieb bestehender Systeme ausgelastet und nicht auf neue KI-Frameworks spezialisiert. Ohne gezielte Weiterbildung und Fachpersonal wirken KI-Projekte schnell unüberschaubar und riskant – was die Zurückhaltung verstärkt.
Juristische Abteilungen dominieren Entscheidungen
In vielen Verwaltungen liegt die finale Bewertung von KI-Vorhaben bei den Rechtsabteilungen. Diese konzentrieren sich naturgemäß auf Haftungsfragen und Rechtskonformität, während technisches Potenzial oft zu kurz kommt. Da die Einbindung von IT-Expertise fehlt, erscheinen KI-Systeme riskanter, als sie sind. Im Zweifel wird gebremst statt umgesetzt.
Die Folge: Aus rein juristischer Perspektive erscheinen viele KI-Systeme risikobehafteter, als sie es bei ganzheitlicher Betrachtung wären. Ohne das Gegengewicht technischer Einschätzung wird im Zweifel eher auf Nummer sicher gegangen: im Zweifelsfall wird gegen ein KI-Projekt entschieden oder strenge Auflagen verlangt. Diese juristische Dominanz kann dazu führen, dass Digitalisierungsprojekte ausgebremst werden.
Zwischen Regulierung und Innovation: Zwei mögliche Wege
Die KI-Verordnung muss nicht zwingend zur Innovationsbremse werden. Sie folgt einem risikobasierten Ansatz: Je höher das Risiko, desto strenger die Auflagen. Niedrigriskante Systeme müssen hingegen meist nur Transparenz- oder Dokumentationspflichten erfüllen. Damit bedeutet die Einordnung als KI nicht automatisch das Aus für ein Projekt.
Mit klarer Dokumentation und nachvollziehbarer Gestaltung lassen sich viele Anforderungen erfüllen. Ob die KI-VO Bremse oder Motor der Digitalisierung wird, hängt also von der praktischen Umsetzung in den Verwaltungen ab.
Fazit: Erfolgreiche Umsetzung durch interdisziplinäre Zusammenarbeit
Der EU AI Act ist kein Technologieverbot, sondern eine Chance für den sicheren und vertrauenswürdigen Einsatz von KI. Damit er nicht zur Blockade wird, braucht es eine realistische Auslegung und vor allem interdisziplinäre Zusammenarbeit: Juristen und Techniker müssen ihre Perspektiven zusammenführen, um KI-Projekte sowohl rechtskonform als auch innovationsfördernd zu gestalten.
Die Erfahrungen mit der DSGVO haben gezeigt, dass fehlende Strukturen und Weiterbildung zu einem Klima der Vermeidung führen. Gelingt diesmal ein integrativer Ansatz, kann die KI-Verordnung ihr Potenzial entfalten und die Verwaltung ins digitale Zeitalter führen, ohne Innovation zu ersticken.

Head of Finance
Larissa studiert Rechtswissenschaften an der Universität zu Köln und arbeitet als Werkstudentin in einer Steuerkanzlei. Neben dem Studium verbindet sie ihr Interesse auch mit dem Recht der Digitalisierung. Deshalb engagiert sie sich ehrenamtlich für das Legal Tech Lab und teilt ihr Fachwissen regelmäßig durch Blogbeiträge.
